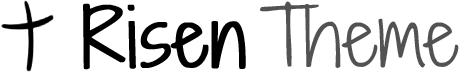Eintrag 58, KW20/ 2021
„Eine pfingstlich-kritische Selbstvergewisserung“
Kirchliches Bauen sollte immer auch einer geistlichen Haltung entspringen und über die eigenen theologischen Motive der Akteure Rechenschaft ablegen. Das Leben ist zwar grundsätzlich eine Baustelle. Leben heißt Veränderung und beinhaltet Neuaufbrüche. Doch solchen Summen, die aktuell verbaut werden sollen, muss man wohl auch immer wieder das eigene Tun selbstkritisch hinterfragen. Angeregt hat mich dazu die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die in diesem Jahr am Pfingstsonntag Predigttext ist. Da heißt es wörtlich: „Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.“ (1. Mose 11,2-4)
Es scheint so, dass zum Menschsein die Selbstverwirklichung durchs Bauen gehört. Für die Generation meiner Eltern war das eigene Haus ein wichtiges Lebensziel. Die Arbeiter wollten raus aus den engen Mietwohnungen, andere hatten durch Krieg und Vertreibung alles verloren. Die eigenen vier Wände bedeuteten Sicherheit, Status und Lebensqualität – und eine Wertanlage für die Kinder, die es einmal besser haben sollten. Zu Parametern eines gelingenden Lebens wurden erhoben: An einem Ort bleiben dürfen. Etwas hinterlassen können.
Derart geprägt, bauen wir bis heute privat oft mehr oder größer, als wir meist bräuchten. Die Generation meiner Eltern hat sich verschuldet, hat Wochenende für Wochenende auf der Baustelle verbracht und sich den Rücken krumm gearbeitet. Sie bauten Häuser, die oftmals größer sind, als dass sie sie im Alter noch sinnvoll bewirtschaften könnten. Sie stehen an Orten, in denen wir Nachkommen sie nicht nutzen, weil uns unser Beruf, unsere eigenen Familien oder unsere Lebensideale anderswohin geführt haben. Viele Familien stellt das vor Probleme, wenn die Eltern pflegebedürftig werden und die Kinder weggezogen sind. Was legen wir uns und den Generationen nach uns nicht alles auf mit unserer eifrigen Bautätigkeit?
In unseren Institutionen und Verbänden ist das nicht anders: Keine Kirchengemeinde ohne Bauausschuss, keine Kirchenvorstandssitzung ohne Tagesordnungspunkt „Bausachen“. Die Bewahrung kirchlicher Liegenschaften bindet Zeit, die von der Arbeit mit Menschen abgeht. Mittel, die anderswo fehlen. Räume, die wir oft gar nicht wirtschaftlich deckend ausnützen, an die wir uns jedoch emotional gebunden fühlen. Warum eigentlich?
Die Leute von Babel sprechen aus, warum sie ihren Turm bauen wollen. Die Sehnsucht nach „einem Namen“ treibt sie an. Sie wollen sich „verewigen“, indem sie sich ein Denkmal setzen! Merken sie nicht, wie sie sich dabei selbst versklaven? „Lasst uns Ziegel streichen und brennen!“ In der hebräischen Bibel steht hier ein Ausdruck, der sonst nur noch an einer einzigen anderen Stelle der Bibel vorkommt: Im 2. Buch Mose (5,7). Da wird erzählt, wie die Israeliten als Sklaven für den Pharao Ziegel brennen – mit genau dem Ausdruck, den es sonst nur hier gibt.
Früher waren die Kirchen oft die einzigen repräsentativen Gebäude eines Dorfes. In den meisten Fällen wurden sie von Kirchenfürsten oder kirchlichen Stiftungsfonts finanziert, weil die eigene Bevölkerung dazu zu arm gewesen wäre. Das war in Sandhausen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht anders. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Längst dominieren unsere Kirchen nicht mehr Orts- und Stadtbilder. Das korreliert mit der sinkenden Bedeutung der Kirche in der westlichen Gesellschaft. Und wir sollten uns nicht dadurch wieder einen Namen machen wollen, indem wir den kirchlichen Dominanzzeiten im Mittelalter und der frühen Neuzeit hinterhertrauern, in der unsere Kirchen gebaut wurden. Kirchliche Prunkbauten gehören der Vergangenheit an. Bescheidenheit und Konzentration der räumlichen, materiellen und persönlichen Ressourcen sollten neben der Verantwortung für die Bewahrung historischer Gebäude oberstes Ziel werden.
Der Respekt vor den alten Mauern und der Bauleistung der Altvorderen gehört zu unseren Wurzeln. Sie dürfen uns jedoch intern nicht zum sprichwörtlichen Kirchturmdenken verführen. Gleichwohl verkündet der Kirchturm der Christuskirche eine wichtige Botschaft. Gerade einer Gesellschaft, die mit uns und unserem Glauben mehrheitlich immer weniger anzufangen weiß, zeigt er: Wir sind immer noch da! Und wir werden auch nicht von der Bildfläche verschwinden, so unbequem Christen und christliches Denken in einer immer stärker und einseitiger auf Profit ausgerichteten Gesellschaft manchmal auch sein mögen. Wir handeln nicht im eigenen Namen, sondern im Namen unseres dreieinigen Gottes.
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel endet mit der Verwirrung der Sprache und der Zerstreuung. Vielfalt (heute sprechen wir wohl eher von Diversität) ist von Gott gewollt. Im Chor der verschiedenen Stimmen wollen wir durch unser Bauvorhaben auch in Zukunft selbstbewusst auftreten und aus der Warte des Glaubens das Ortsbild und das Ortsgespräch gleichermaßen bereichern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Mit herzlichen Grüßen,
Bernhard Wielandt, Pfr.